PARIS – In der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich stoßen Klimaschutz-bestrebungen zunehmend auf makroökonomischen Gegenwind.
Ende Mai erteilte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire der Idee, Frankreichs Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft durch die Aufnahme weiterer Schulden zu finanzieren, eine entschiedene Absage. Nur wenige Tage später ruderte die britische Schatten-Finanzministerin Rachel Reeves hinsichtlich eines Wahlversprechens zurück, im Rahmen dessen jährlich 28 Milliarden Pfund (32,6 Milliarden Euro) zur Finanzierung von Klimainvestitionen aufgenommen hätten werden sollen. Heute verspricht sie, dass eine Labour-Regierung, sollte sie gewählt werden, fiskalisch „verantwortungsvoll“ vorgehen und die grünen Investitionen des Landes nur schrittweise erhöhen würde. Und in Deutschland wurde ein vom grünen Vizekanzler Robert Habeck vorangetriebener Gesetzesentwurf verwässert, nachdem sich Finanzminister Christian Lindner von den Freien Demokraten gegen ein zuvor vereinbartes Verbot neuer Gasheizungen in Wohngebäuden ausgesprochen hatte.
Es ist kein Zufall, dass Klimaschutzverpflichtungen einen zunehmend prominenten Platz in der allgemeineren makroökonomischen Debatte einnehmen. Zur Verringerung der Treibhausgasemissionen sind massive Investitionen erforderlich - in der Größenordnung von jährlich etwa 2 Prozent des BIP in Ländern, die bis 2050 ernsthaft Klimaneutralität anstreben – wobei je nach Land zwischen einem Drittel und der Hälfte der Ausgaben aus öffentlichen Haushalten zu finanzieren sein werden.
In Zeiten niedriger oder negativer Zinsen war das kein großes Thema, aber nun, da die Kreditkosten gestiegen sind, herrscht ein Gefühl der wirtschaftlichen Unsicherheit. Haushaltspolitische Hardliner gehen in die Offensive und Befürworter von Klimaschutzinvestitionen geraten zunehmend in Rückzugsgefechte, um ihre frühere Dynamik zu erhalten.
Bislang wurde dieses Thema in den Debatten über die Reform des fiskalpolitischen Rahmens der EU vermieden. Diese gestalten sich ohnehin schon komplex genug, weshalb Klimainvestitionen und deren Finanzierung weder in den Gesetzgebungsvorschlägen der Europäischen Kommission noch in den jüngsten Reform-Leitlinien der EU-Finanzminister groß erwähnt werden. Und dennoch kann die Frage, ob Klimaschutzmaßnahmen Vorrang vor Schuldenabbau haben sollten, nicht übergangen werden, zumal sich die EU bereits verpflichtet hat, ihre Emissionen bis 2030 deutlich zu senken.
Für Länder, deren fiskalische Nachhaltigkeit in Frage steht, ist die Antwort einfach. Es liegt auf der Hand, dass eine Regierung, der es an finanziellem Spielraum mangelt, ihre Zahlungsfähigkeit nicht im Namen des Klimaschutzes aufs Spiel setzen sollte. Für sie gilt es vielmehr, zunächst die öffentlichen Ausgaben zu restrukturieren oder Hilfe von der EU zu erhalten. Die meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften fallen jedoch nicht in diese Kategorie. Sie verfügen zumindest über einen gewissen fiskalischen Spielraum, und es besteht wachsender Bedarf an Leitlinien, wie dieser genutzt werden sollte.
Das Abrücken von früheren Zusagen offenbart einen Mangel an systematischen Überlegungen über die Vor- und Nachteile von steuer- oder schuldenfinanzierten Klimainvestitionen. In dem Maße, in dem sich derartige Investitionen am Ende rechnen (durch niedrigere Betriebskosten oder eine verbesserte Umwelt), spricht - selbst unter verschärften finanziellen Bedingungen - weiterhin viel für Schuldenfinanzierung. So mag beispielsweise die Anschaffung einer Wärmepumpe hohe Kosten verursachen, aber letztendlich senkt sie die Kosten für fossile Brennstoffe und sorgt für sauberere Luft, von den positiven Auswirkungen auf die Emissionen ganz zu schweigen. Gleiches gilt für den Ersatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor durch Elektrofahrzeuge.
Allerdings werden Steuereinnahmen, die zur Bedienung der neuen Schulden benötigt werden, nicht automatisch generiert. Damit ein potenzieller Nutzen in tatsächliche Einnahmen mündet, muss entweder eine ausdrückliche Entscheidung zur Besteuerung getroffen oder ein spezielles Finanzierungssystem geschaffen werden. In der Praxis sollten die künftigen Einsparungen aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen in einer Weise zweckgebunden sein, die die Rückzahlung der zur Finanzierung der Investitionen aufgenommenen Schulden ermöglicht.
Dieser Ansatz dürfte recht einfach umzusetzen sein, wenn es beispielsweise um die Sanierung öffentlicher Gebäude zwecks Verbesserung der Effizienz geht. Freilich könnten bei der Finanzierung von Sanierungsarbeiten Finanzinstitutionen an die Stelle lokaler Verwaltungen treten und Rückzahlungen später aus den Einsparungen bei den Heizkosten erfolgen. Das wäre jedoch kostspielig, wenn nicht gar absurd. Mit Ausnahme von Ländern mit nicht tragfähiger Verschuldung bleibt der Staat Referenzschuldner und zahlt daher weniger auf seine Verbindlichkeiten als private Investoren. Anstatt sich zu höheren Barwertzahlungen zu verpflichten und damit ihre Zahlungsfähigkeit zu untergraben, sollten die Regierungen Schulden aufnehmen und sie durch künftige Einsparungen bei den Heizkosten bedienen.
Eine noch größere Herausforderung besteht darin, die Kosten für die Gebäudesanierung zu minimieren, die den größten Teil der Übergangskosten in Europa ausmachen. Etwa 70 Prozent der Haushalte in der EU sind Eigentümer ihrer Häuser und Wohnungen (in Rumänien oder der Slowakei liegt dieser Anteil bei 90 Prozent). Zwar können private Quellen dazu beitragen, geeignete Finanzierungskanäle zu erschließen und so eine direkte Beteiligung des Staates zu vermeiden, doch dürften die Kosten derartiger Systeme für die einzelnen Haushalte hoch sein. Private Finanzierungen sind bei kleinen Investitionen einfach nicht effektiv, vor allem wenn es sich bei den Kreditnehmern um Haushalte mit niedrigem Einkommen oder der Mittelschicht handelt und die private Rentabilität der Investition gering ist. In derartigen Fällen - mehrheitlich in den EU-Ländern - könnte die zögerliche Einbindung des Staates zu kostspieligen Umwegen führen.
Obwohl es keine Patentlösung für alle Probleme gibt, spricht vieles dafür, einen Teil der erforderlichen Klimainvestitionen durch die Begebung öffentlicher Schuldtitel zu finanzieren. Manche Klimainvestitionen sind von Natur aus privat, andere zwangsläufig öffentlich. Was dazwischen liegt, kann entweder privat finanziert oder aus öffentlichen Haushalten unterstützt werden, wobei Kostenreduzierung das Leitprinzip sein sollte.
Mehr als die Hälfte der EU-Länder wiesen Ende 2022 eine Schuldenquote von über 60 Prozent des BIP auf. Diese Staaten sehen sich mit den widersprüchlichen Forderungen konfrontiert, einerseits in die Reduzierung der Emissionen zu investieren und andererseits ihre Schuldenquote zu senken. Die EU kann diese Diskrepanz nicht länger übergehen, und sie kann auch nicht erwarten, dass die Mitgliedstaaten das Problem allein lösen. Europa muss dringend eine ernsthafte Diskussion über die Rolle der Schuldenfinanzierung bei der Erfüllung seiner Klimaverpflichtungen führen.
Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier
Jean Pisani-Ferry ist Senior Fellow bei der in Brüssel ansässigen Denkfabrik Bruegel,





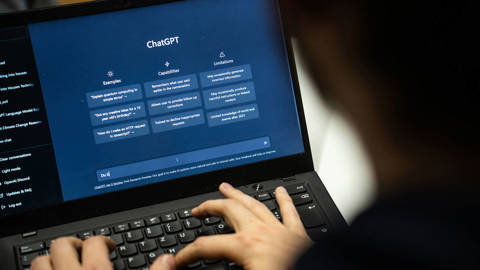






PARIS – In der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich stoßen Klimaschutz-bestrebungen zunehmend auf makroökonomischen Gegenwind.
Ende Mai erteilte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire der Idee, Frankreichs Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft durch die Aufnahme weiterer Schulden zu finanzieren, eine entschiedene Absage. Nur wenige Tage später ruderte die britische Schatten-Finanzministerin Rachel Reeves hinsichtlich eines Wahlversprechens zurück, im Rahmen dessen jährlich 28 Milliarden Pfund (32,6 Milliarden Euro) zur Finanzierung von Klimainvestitionen aufgenommen hätten werden sollen. Heute verspricht sie, dass eine Labour-Regierung, sollte sie gewählt werden, fiskalisch „verantwortungsvoll“ vorgehen und die grünen Investitionen des Landes nur schrittweise erhöhen würde. Und in Deutschland wurde ein vom grünen Vizekanzler Robert Habeck vorangetriebener Gesetzesentwurf verwässert, nachdem sich Finanzminister Christian Lindner von den Freien Demokraten gegen ein zuvor vereinbartes Verbot neuer Gasheizungen in Wohngebäuden ausgesprochen hatte.
Es ist kein Zufall, dass Klimaschutzverpflichtungen einen zunehmend prominenten Platz in der allgemeineren makroökonomischen Debatte einnehmen. Zur Verringerung der Treibhausgasemissionen sind massive Investitionen erforderlich - in der Größenordnung von jährlich etwa 2 Prozent des BIP in Ländern, die bis 2050 ernsthaft Klimaneutralität anstreben – wobei je nach Land zwischen einem Drittel und der Hälfte der Ausgaben aus öffentlichen Haushalten zu finanzieren sein werden.
In Zeiten niedriger oder negativer Zinsen war das kein großes Thema, aber nun, da die Kreditkosten gestiegen sind, herrscht ein Gefühl der wirtschaftlichen Unsicherheit. Haushaltspolitische Hardliner gehen in die Offensive und Befürworter von Klimaschutzinvestitionen geraten zunehmend in Rückzugsgefechte, um ihre frühere Dynamik zu erhalten.
Bislang wurde dieses Thema in den Debatten über die Reform des fiskalpolitischen Rahmens der EU vermieden. Diese gestalten sich ohnehin schon komplex genug, weshalb Klimainvestitionen und deren Finanzierung weder in den Gesetzgebungsvorschlägen der Europäischen Kommission noch in den jüngsten Reform-Leitlinien der EU-Finanzminister groß erwähnt werden. Und dennoch kann die Frage, ob Klimaschutzmaßnahmen Vorrang vor Schuldenabbau haben sollten, nicht übergangen werden, zumal sich die EU bereits verpflichtet hat, ihre Emissionen bis 2030 deutlich zu senken.
Für Länder, deren fiskalische Nachhaltigkeit in Frage steht, ist die Antwort einfach. Es liegt auf der Hand, dass eine Regierung, der es an finanziellem Spielraum mangelt, ihre Zahlungsfähigkeit nicht im Namen des Klimaschutzes aufs Spiel setzen sollte. Für sie gilt es vielmehr, zunächst die öffentlichen Ausgaben zu restrukturieren oder Hilfe von der EU zu erhalten. Die meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften fallen jedoch nicht in diese Kategorie. Sie verfügen zumindest über einen gewissen fiskalischen Spielraum, und es besteht wachsender Bedarf an Leitlinien, wie dieser genutzt werden sollte.
SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.
Subscribe Now
Das Abrücken von früheren Zusagen offenbart einen Mangel an systematischen Überlegungen über die Vor- und Nachteile von steuer- oder schuldenfinanzierten Klimainvestitionen. In dem Maße, in dem sich derartige Investitionen am Ende rechnen (durch niedrigere Betriebskosten oder eine verbesserte Umwelt), spricht - selbst unter verschärften finanziellen Bedingungen - weiterhin viel für Schuldenfinanzierung. So mag beispielsweise die Anschaffung einer Wärmepumpe hohe Kosten verursachen, aber letztendlich senkt sie die Kosten für fossile Brennstoffe und sorgt für sauberere Luft, von den positiven Auswirkungen auf die Emissionen ganz zu schweigen. Gleiches gilt für den Ersatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor durch Elektrofahrzeuge.
Allerdings werden Steuereinnahmen, die zur Bedienung der neuen Schulden benötigt werden, nicht automatisch generiert. Damit ein potenzieller Nutzen in tatsächliche Einnahmen mündet, muss entweder eine ausdrückliche Entscheidung zur Besteuerung getroffen oder ein spezielles Finanzierungssystem geschaffen werden. In der Praxis sollten die künftigen Einsparungen aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen in einer Weise zweckgebunden sein, die die Rückzahlung der zur Finanzierung der Investitionen aufgenommenen Schulden ermöglicht.
Dieser Ansatz dürfte recht einfach umzusetzen sein, wenn es beispielsweise um die Sanierung öffentlicher Gebäude zwecks Verbesserung der Effizienz geht. Freilich könnten bei der Finanzierung von Sanierungsarbeiten Finanzinstitutionen an die Stelle lokaler Verwaltungen treten und Rückzahlungen später aus den Einsparungen bei den Heizkosten erfolgen. Das wäre jedoch kostspielig, wenn nicht gar absurd. Mit Ausnahme von Ländern mit nicht tragfähiger Verschuldung bleibt der Staat Referenzschuldner und zahlt daher weniger auf seine Verbindlichkeiten als private Investoren. Anstatt sich zu höheren Barwertzahlungen zu verpflichten und damit ihre Zahlungsfähigkeit zu untergraben, sollten die Regierungen Schulden aufnehmen und sie durch künftige Einsparungen bei den Heizkosten bedienen.
Eine noch größere Herausforderung besteht darin, die Kosten für die Gebäudesanierung zu minimieren, die den größten Teil der Übergangskosten in Europa ausmachen. Etwa 70 Prozent der Haushalte in der EU sind Eigentümer ihrer Häuser und Wohnungen (in Rumänien oder der Slowakei liegt dieser Anteil bei 90 Prozent). Zwar können private Quellen dazu beitragen, geeignete Finanzierungskanäle zu erschließen und so eine direkte Beteiligung des Staates zu vermeiden, doch dürften die Kosten derartiger Systeme für die einzelnen Haushalte hoch sein. Private Finanzierungen sind bei kleinen Investitionen einfach nicht effektiv, vor allem wenn es sich bei den Kreditnehmern um Haushalte mit niedrigem Einkommen oder der Mittelschicht handelt und die private Rentabilität der Investition gering ist. In derartigen Fällen - mehrheitlich in den EU-Ländern - könnte die zögerliche Einbindung des Staates zu kostspieligen Umwegen führen.
Obwohl es keine Patentlösung für alle Probleme gibt, spricht vieles dafür, einen Teil der erforderlichen Klimainvestitionen durch die Begebung öffentlicher Schuldtitel zu finanzieren. Manche Klimainvestitionen sind von Natur aus privat, andere zwangsläufig öffentlich. Was dazwischen liegt, kann entweder privat finanziert oder aus öffentlichen Haushalten unterstützt werden, wobei Kostenreduzierung das Leitprinzip sein sollte.
Mehr als die Hälfte der EU-Länder wiesen Ende 2022 eine Schuldenquote von über 60 Prozent des BIP auf. Diese Staaten sehen sich mit den widersprüchlichen Forderungen konfrontiert, einerseits in die Reduzierung der Emissionen zu investieren und andererseits ihre Schuldenquote zu senken. Die EU kann diese Diskrepanz nicht länger übergehen, und sie kann auch nicht erwarten, dass die Mitgliedstaaten das Problem allein lösen. Europa muss dringend eine ernsthafte Diskussion über die Rolle der Schuldenfinanzierung bei der Erfüllung seiner Klimaverpflichtungen führen.
Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier
Jean Pisani-Ferry ist Senior Fellow bei der in Brüssel ansässigen Denkfabrik Bruegel,