LJUBLJANA: Man müsse, so schrieb Reinhard Heydrich, einer der Architekten des Holocausts, 1935, die Juden in zwei Kategorien unterteilen: die Zionisten und die Anhänger der Assimilation. „Die Zionisten halten sich streng an einen Rassenstandpunkt und helfen mit ihrer Auswanderung nach Palästina beim Aufbau ihres eigenen jüdischen Staates ... [U]nsere guten Wünsche und unser offizielles Wohlwollen gehen mit ihnen.“
Von der Warte Heydrichs aus betrachtet stellte der Aufbau des Staates Israel somit den Triumph des Zionismus über den Assimilationismus dar. Er komplizierte aber auch die traditionelle antisemitische Wahrnehmung der Juden als entwurzeltes, wurzelloses Volk, wie sie Martin Heideggers im Jahr 1939 vertrat, als er eine Untersuchung der „eigentümliche[n] Vorbestimmung der Judenschaft für das planetarische Verbrechertum“ forderte:
„Die Juden ‚leben‘ bei ihrer betont rechnerischen Begabung am längsten schon nach dem Rasseprinzip, weshalb sie sich auch am heftigsten gegen die uneingeschränkte Anwendung zur Wehr setzten. Die Einrichtung der rassischen Aufzucht entstammt nicht dem Leben selbst, sondern der Übermächtigung des Lebens durch die Machenschaft. Was diese mit solcher Planung betreibt, ist eine vollständige Entrassung der Völker durch die Einspannung derselben in die gleich gebaute und gleichschnittige Einrichtung alles Seienden. Mit der Entrassung geht eine Selbstentfremdung der Völker ineins – der Verlust der Geschichte – d. h. der Entscheidungsbezirke zum Seyn.“
Diesen Zeilen liegt der philosophische Gegensatz zugrunde zwischen einem vollständigen Leben in einer konkreten Welt und der Verleugnung derartiger spirituell-historischer Wurzeln durch Betrachtung aller „äußeren Realität“ als bloß etwas, das manipuliert und ausgebeutet werden kann. Was jedoch geschieht, wenn eine vermeintlich wurzellose kosmopolitische Rasse beginnt, Wurzeln zu schlagen? Mit dem Zionismus, so der französische Philosoph Alain Finkielkraut 2015, „haben die Juden heute den Weg der Verwurzelung gewählt.“
Aus dieser Behauptung lässt sich leicht ein Echo der Überzeugung Heideggers herauslesen, dass alle wesentlichen und großen Dinge eine „Blut- und Boden“-Heimat benötigen. Die Ironie dabei ist, dass zur Legitimierung des Zionismus antisemitische Klischees über Wurzellosigkeit beschworen werden. Während der Antisemitismus den Juden vorwirft, wurzellos zu sein, versucht der Zionismus, dieses vermeintliche Versagen zu korrigieren. Kein Wunder, dass viele konservative Antisemiten bis heute lautstark die Expansion Israels unterstützen. Das Problem ist natürlich, dass Expansion unter der Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu nun die Besiedlung und Annexion des Westjordanlands bedeutet. Damit wird eine Verwurzelung an einem Ort angestrebt, der jahrhundertelang von anderen Menschen bewohnt wurde.
Ein ähnliches Problem begegnet uns bei den unterschiedlichen Interpretationen des traditionellen jüdischen Spruchs „Nächstes Jahr in Jerusalem“, der am Ende des Seders (des rituellen Mahls, das den Beginn des Passahfestes markiert) ausgesprochen wird. Wie Dara Lind (Vox) erklärt:
„Aus Sicht vieler von der Wichtigkeit eines jüdischen Staates überzeugter Juden verleiht ‚Nächstes Jahr in Jerusalem‘ der Notwendigkeit Ausdruck, Jerusalem und Israel, so wie sie heute existieren, zu schützen. Andere denken bei dem im Seder erwähnten ‚Jerusalem‘ eher an ein Ideal dessen, was Jerusalem und Israel sein könnten – für sie ist ‚Nächstes Jahr in Jerusalem‘ ein Gebet, dass Israel sich diesem Ideal annähern möge. Oder ‚Jerusalem‘ könnte einfach ein allgemeineres utopisches Symbol sein, und ‚Nächstes Jahr in Jerusalem‘ könnte ein Vorsatz sein, im neuen Jahr Frieden auf Erden zu schaffen.“
Diese Versionen reproduzieren die Dualität des Transzendentalen und des Empirischen. „Jerusalem“ ist dabei entweder ein abstrakter spiritueller Ort der Erlösung oder eine tatsächliche Stadt mit echten Menschen, Gebäuden und religiösen Denkmälern. Es überrascht nicht, dass einige muslimische Fundamentalisten den „Transzendentalisten“, die die Überhöhung des realen Jerusalems als Blasphemie betrachten, relativ wohlgesonnen sind. Als in den 2000er Jahren der damalige iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad eine Konferenz ausrichtete, die die Auslöschung des Staates Israel forderte, empfing er dabei auch einige freundliche „transzendentalistische“ Rabbiner. Es war eine Umkehrung der Sichtweise Heydrichs: Juden in unserer Mitte zu haben ist in Ordnung; der jüdische Staat ist das Unannehmbare.
Doch gibt es noch eine dritte, zutiefst gefährliche Version von „Nächstes Jahr in Jerusalem“, die eine Synthese der beiden vorgenannten darstellt. Ihre Vertreter sagen: „Nun, da wir Jerusalem haben, können wir das neue Jahr nutzen, um die palästinensischen Gebäude niederzureißen und dort, wo gegenwärtig die Al-Aksa-Moschee steht, den biblischen Tempel wiedererrichten.“ Der Kampf um Jerusalem wird somit zu einem heiligen Unterfangen. Selbst wenn ein Verbrechen begangen wird, werden die Täter (in ihren Augen) keine Schuld tragen, weil sie eine neue legitime Ordnung gründen. Es ist wie der alte Witz, in dem die Dorfbewohner prahlen, es gäbe vor Ort keine Kannibalen mehr: „Den letzten haben wir gestern gegessen.“
Aber lassen Sie uns klarstellen, was wirklich vor sich geht. Indem sie die jüdische Opferrolle zur Rechtfertigung einer expansionistischen Agenda nutzen, missbrauchen die die Annexionen befürwortenden Israelis in zynischer Weise die Erinnerung an den Holocaust. Diejenigen, die Israel bedingungslose Unterstützung leisten, unterstützen somit auch die derzeitige israelische Regierung gegen die liberale Opposition, die sich gegen Siedlungen und Expansion ausspricht. Dabei ist dieser Expansionismus heute eine der Hauptquellen des Antisemitismus in der Welt.
Zu den Ländern, die Israel uneingeschränkt unterstützen, gehört auch Deutschland, wo viele Rechte vor „importierten Antisemitismus“ warnen. Das impliziert, dass eine neue Welle des Antisemitismus in Deutschland kein deutsches Phänomen sei, sondern vielmehr ein Ergebnis muslimischer Einwanderung. Aber warum haben dann so viele junge Linke im Westen es abgelehnt, sich nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober mit Israel zu solidarisieren? Warum verbreiten junge Amerikaner Osama bin Ladens „Brief an Amerika“ auf TikTok?
Es ist zu simpel, zu sagen, dass sie schlicht mit der Hamas sympathisieren. Vielmehr ist vielen, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligen, die breitere Ansicht gemein, dass Außenpolitik und Militärapparate der USA und ihrer westlichen Verbündeten dem Großkapital und seiner Ausbeutung der übrigen Welt verpflichtet sind. Manchmal besteht nur ein sehr schmaler Grat zwischen echter Unzufriedenheit über den Kapitalismus und der Art von „antikapitalistischem“ Populismus, die in Bin Ladens Brief zu finden ist.
Viele Linke haben ihre Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht und zugleich ihre Sorge hinsichtlich der Zahl der Zivilisten – insbesondere der Kinder – geäußert, die in Gaza getötet werden. Es gibt zunehmende Sympathie für die Palästinenser als Opfer, und es wird anerkannt, dass sie das Recht haben, sich gegen expansionistische Übergriffe zu wehren. Aber wie können sie sich wehren, ohne zu Antisemiten zu werden? Das ist eine Frage, die bisher nur verlegenes Schweigen auslöst.
Aus dem Englischen von Jan Doolan





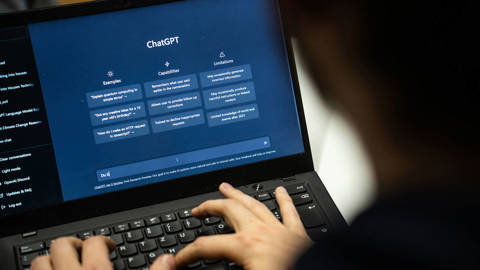






LJUBLJANA: Man müsse, so schrieb Reinhard Heydrich, einer der Architekten des Holocausts, 1935, die Juden in zwei Kategorien unterteilen: die Zionisten und die Anhänger der Assimilation. „Die Zionisten halten sich streng an einen Rassenstandpunkt und helfen mit ihrer Auswanderung nach Palästina beim Aufbau ihres eigenen jüdischen Staates ... [U]nsere guten Wünsche und unser offizielles Wohlwollen gehen mit ihnen.“
Von der Warte Heydrichs aus betrachtet stellte der Aufbau des Staates Israel somit den Triumph des Zionismus über den Assimilationismus dar. Er komplizierte aber auch die traditionelle antisemitische Wahrnehmung der Juden als entwurzeltes, wurzelloses Volk, wie sie Martin Heideggers im Jahr 1939 vertrat, als er eine Untersuchung der „eigentümliche[n] Vorbestimmung der Judenschaft für das planetarische Verbrechertum“ forderte:
„Die Juden ‚leben‘ bei ihrer betont rechnerischen Begabung am längsten schon nach dem Rasseprinzip, weshalb sie sich auch am heftigsten gegen die uneingeschränkte Anwendung zur Wehr setzten. Die Einrichtung der rassischen Aufzucht entstammt nicht dem Leben selbst, sondern der Übermächtigung des Lebens durch die Machenschaft. Was diese mit solcher Planung betreibt, ist eine vollständige Entrassung der Völker durch die Einspannung derselben in die gleich gebaute und gleichschnittige Einrichtung alles Seienden. Mit der Entrassung geht eine Selbstentfremdung der Völker ineins – der Verlust der Geschichte – d. h. der Entscheidungsbezirke zum Seyn.“
Diesen Zeilen liegt der philosophische Gegensatz zugrunde zwischen einem vollständigen Leben in einer konkreten Welt und der Verleugnung derartiger spirituell-historischer Wurzeln durch Betrachtung aller „äußeren Realität“ als bloß etwas, das manipuliert und ausgebeutet werden kann. Was jedoch geschieht, wenn eine vermeintlich wurzellose kosmopolitische Rasse beginnt, Wurzeln zu schlagen? Mit dem Zionismus, so der französische Philosoph Alain Finkielkraut 2015, „haben die Juden heute den Weg der Verwurzelung gewählt.“
Aus dieser Behauptung lässt sich leicht ein Echo der Überzeugung Heideggers herauslesen, dass alle wesentlichen und großen Dinge eine „Blut- und Boden“-Heimat benötigen. Die Ironie dabei ist, dass zur Legitimierung des Zionismus antisemitische Klischees über Wurzellosigkeit beschworen werden. Während der Antisemitismus den Juden vorwirft, wurzellos zu sein, versucht der Zionismus, dieses vermeintliche Versagen zu korrigieren. Kein Wunder, dass viele konservative Antisemiten bis heute lautstark die Expansion Israels unterstützen. Das Problem ist natürlich, dass Expansion unter der Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu nun die Besiedlung und Annexion des Westjordanlands bedeutet. Damit wird eine Verwurzelung an einem Ort angestrebt, der jahrhundertelang von anderen Menschen bewohnt wurde.
Ein ähnliches Problem begegnet uns bei den unterschiedlichen Interpretationen des traditionellen jüdischen Spruchs „Nächstes Jahr in Jerusalem“, der am Ende des Seders (des rituellen Mahls, das den Beginn des Passahfestes markiert) ausgesprochen wird. Wie Dara Lind (Vox) erklärt:
SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.
Subscribe Now
„Aus Sicht vieler von der Wichtigkeit eines jüdischen Staates überzeugter Juden verleiht ‚Nächstes Jahr in Jerusalem‘ der Notwendigkeit Ausdruck, Jerusalem und Israel, so wie sie heute existieren, zu schützen. Andere denken bei dem im Seder erwähnten ‚Jerusalem‘ eher an ein Ideal dessen, was Jerusalem und Israel sein könnten – für sie ist ‚Nächstes Jahr in Jerusalem‘ ein Gebet, dass Israel sich diesem Ideal annähern möge. Oder ‚Jerusalem‘ könnte einfach ein allgemeineres utopisches Symbol sein, und ‚Nächstes Jahr in Jerusalem‘ könnte ein Vorsatz sein, im neuen Jahr Frieden auf Erden zu schaffen.“
Diese Versionen reproduzieren die Dualität des Transzendentalen und des Empirischen. „Jerusalem“ ist dabei entweder ein abstrakter spiritueller Ort der Erlösung oder eine tatsächliche Stadt mit echten Menschen, Gebäuden und religiösen Denkmälern. Es überrascht nicht, dass einige muslimische Fundamentalisten den „Transzendentalisten“, die die Überhöhung des realen Jerusalems als Blasphemie betrachten, relativ wohlgesonnen sind. Als in den 2000er Jahren der damalige iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad eine Konferenz ausrichtete, die die Auslöschung des Staates Israel forderte, empfing er dabei auch einige freundliche „transzendentalistische“ Rabbiner. Es war eine Umkehrung der Sichtweise Heydrichs: Juden in unserer Mitte zu haben ist in Ordnung; der jüdische Staat ist das Unannehmbare.
Doch gibt es noch eine dritte, zutiefst gefährliche Version von „Nächstes Jahr in Jerusalem“, die eine Synthese der beiden vorgenannten darstellt. Ihre Vertreter sagen: „Nun, da wir Jerusalem haben, können wir das neue Jahr nutzen, um die palästinensischen Gebäude niederzureißen und dort, wo gegenwärtig die Al-Aksa-Moschee steht, den biblischen Tempel wiedererrichten.“ Der Kampf um Jerusalem wird somit zu einem heiligen Unterfangen. Selbst wenn ein Verbrechen begangen wird, werden die Täter (in ihren Augen) keine Schuld tragen, weil sie eine neue legitime Ordnung gründen. Es ist wie der alte Witz, in dem die Dorfbewohner prahlen, es gäbe vor Ort keine Kannibalen mehr: „Den letzten haben wir gestern gegessen.“
Aber lassen Sie uns klarstellen, was wirklich vor sich geht. Indem sie die jüdische Opferrolle zur Rechtfertigung einer expansionistischen Agenda nutzen, missbrauchen die die Annexionen befürwortenden Israelis in zynischer Weise die Erinnerung an den Holocaust. Diejenigen, die Israel bedingungslose Unterstützung leisten, unterstützen somit auch die derzeitige israelische Regierung gegen die liberale Opposition, die sich gegen Siedlungen und Expansion ausspricht. Dabei ist dieser Expansionismus heute eine der Hauptquellen des Antisemitismus in der Welt.
Zu den Ländern, die Israel uneingeschränkt unterstützen, gehört auch Deutschland, wo viele Rechte vor „importierten Antisemitismus“ warnen. Das impliziert, dass eine neue Welle des Antisemitismus in Deutschland kein deutsches Phänomen sei, sondern vielmehr ein Ergebnis muslimischer Einwanderung. Aber warum haben dann so viele junge Linke im Westen es abgelehnt, sich nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober mit Israel zu solidarisieren? Warum verbreiten junge Amerikaner Osama bin Ladens „Brief an Amerika“ auf TikTok?
Es ist zu simpel, zu sagen, dass sie schlicht mit der Hamas sympathisieren. Vielmehr ist vielen, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligen, die breitere Ansicht gemein, dass Außenpolitik und Militärapparate der USA und ihrer westlichen Verbündeten dem Großkapital und seiner Ausbeutung der übrigen Welt verpflichtet sind. Manchmal besteht nur ein sehr schmaler Grat zwischen echter Unzufriedenheit über den Kapitalismus und der Art von „antikapitalistischem“ Populismus, die in Bin Ladens Brief zu finden ist.
Viele Linke haben ihre Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht und zugleich ihre Sorge hinsichtlich der Zahl der Zivilisten – insbesondere der Kinder – geäußert, die in Gaza getötet werden. Es gibt zunehmende Sympathie für die Palästinenser als Opfer, und es wird anerkannt, dass sie das Recht haben, sich gegen expansionistische Übergriffe zu wehren. Aber wie können sie sich wehren, ohne zu Antisemiten zu werden? Das ist eine Frage, die bisher nur verlegenes Schweigen auslöst.
Aus dem Englischen von Jan Doolan