Wenn Europas Staats- und Regierungschefs sich in Portugal versammeln um einem neuen, schlankeren Reformvertrag den letzten Schliff zu geben, so könnte es hilfreich sein, wenn sie alle so tun, als hätten die letzten 50 Jahre europäische Integration nie stattgefunden. Stellen wir uns einmal vor, was Europa tun muss, um seine dringendsten Aufgaben in Angriff zunehmen, insbesondere wenn es dies ohne die politischen Beschränkungen machen könnte, die sich aus 50 Jahren EU-Geschichte ergeben, in denen Übereinkünfte ausgehandelt und marode Institutionen errichtet wurden.
Lassen Sie uns außerdem diese Fantasiereise ausweiten und annehmen, obwohl wir bei diesem EU-Szenario im „Jahre null“ nicht auf ein halbes Jahrhundert der intereuropäischen Kooperation zurückgreifen könnten, dass die Nationen, aus denen die EU derzeit besteht, trotzdem darauf aus wären, weitreichende gemeinsame Beschlüsse zu fassen.
Legen wir also unsere Zweifel ab, und versuchen wir uns vorzustellen, was Europa tun könnte und sollte, um einige der tiefgreifendsten und schwierigsten politischen Herausforderungen zu meistern, die darüber entscheiden werden, ob die nächsten 50 Jahre so konstruktiv sein werden wie die letzten. Anders ausgedrückt: Sehen wir uns unsere Probleme vor dem Hintergrund der bestehenden Mechanismen und dem Potenzial der EU an, weitreichende, neue politische Maßnahmen zu beschließen, und dann wollen wir uns fragen, warum die EU ihr eigenes Potenzial nicht nutzt und diese Leistung nicht erbringt.
Im Großen und Ganzen gibt es drei Bereiche, in denen die europäischen Politiker sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene ihre Sache besser machen können: globale Aufgaben, bei denen Europa aktiver die Führung übernehmen könnte; die Schaffung und Stärkung von Humankapital innerhalb der EU und weltweit; und die Verbesserung der Effektivität der politischen EU-Maschinerie selbst.
Europa braucht eine klarere globale Agenda mit stärkerem Profil. Es muss seine Führungsrolle in der Klimapolitik beträchtlich ausbauen, indem es sich wesentlich strengere EU-Ziele setzt und dann seinen Einfluss in der internationalen Wirtschaft und im Handel nutzt, um für neue weltweite Emissionsnormen einzutreten, die vom wissenschaftlichen Standpunkt aus als sinnvoll gelten.
In Konflikt- und Sicherheitsfragen sollte Europa in eine neue Phase eintreten, in der es bei unterschiedlichen Problemen klarer und eindeutiger Position bezieht, angefangen bei der Verbreitung von Atomwaffen bis hin zu Sanktionen gegen das Militärregime in Birma. Europa sollte sich dadurch als starken und gerechten Akteur auf der Weltbühne etablieren anstatt als „allgemeine Kirche“, in der verschiedene Sichtweisen nebeneinander existieren.
Das Ziel sollte sein, Instrumente der „Soft Power“ (sanfte Macht), wie die EU-Entwicklungshilfe und wirtschaftliche Partnerschaften, mit einem wachsenden Gefühl für Europas politische und sicherheitsstrategische Reichweite zu verbinden, um sicherzustellen, dass mit Europa als globalem Player gerechnet werden kann. Das bedeutet natürlich, dass die EU versuchen sollte, ihr transatlantisches Denken auszuweiten, damit die EU und die Vereinigten Staaten in einer Welt, in der sie gemeinsam kaum mehr als 10 % der Gesamtbevölkerung ausmachen, bei der Definition – und somit auch beim Schutz – ihrer gemeinsamen Interessen enger zusammenarbeiten.
Diese Punkte sind weit davon entfernt, eine allgemeine Kritik an den Bemühungen der EU um eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu sein. Doch sollen sie unterstreichen, was viele Menschen in Europa sehr wohl wissen, nämlich dass das Tempo, mit dem die Probleme in der internationalen Entwicklung und bei Konflikten wachsen, bisher bei weitem schneller ist als die politischen Antworten der EU darauf.
Der Aufbau von mehr Humankapital in Europa und weltweit ist ein ungemein wichtiger Bestandteil der zukünftigen EU-Aktivitäten. Bildung ist die bei weitem profitabelste Investition für Europa, also sollte es die ehrgeizigste Strategie aller Zeiten starten, um eine neue Wissensdynamik und Arbeitsplätze in der EU zu schaffen, während es gleichzeitig dazu beiträgt, die Bildung in den ärmsten Ländern der Welt stark zu verbessern.
Europa muss auch endlich den Stier der Einwanderungspolitik bei den Hörnern packen – ein Problem, das Generationen von führenden Politikern immer wieder entgangen ist. EU-weite Einwanderungsbestimmungen müssen beschlossen werden, um den Hunger des schrumpfenden Europas nach importierten Arbeitskräften mit der weit verbreiteten Angst vor interkulturellen Spannungen und gesellschaftlichen Unruhen in Einklang zu bringen. Es wird nicht einfach sein, ein gerechteres und multikulturelleres Europa zu schaffen, doch wenn dieses Problem nicht offen angesprochen wird, ist der Preis umso höher.
Aus demselben Grund sollten die europäischen Regierungen entschlossen einen neuen Versuch unternehmen, den Sinn der Europäer für ihre gemeinsame Geschichte und gemeinsamen Werte zu stärken. Eine stärkere europäische Identität ist die beste Grundlage zur Schaffung einer multikulturelleren Gesellschaft, die Demographen für unausweichlich halten.
Unterdessen ist die politische und institutionelle Maschinerie, die die EU für die Umsetzung dieser und anderer ehrgeiziger Ziele benötigt, immer noch von Zweifeln umgeben. Die Einigung auf einen Reformvertrag zur Überarbeitung der Entscheidungsmechanismen in der EU wurde Mitte des Jahres mit erleichtertem Aufatmen begrüßt, doch ist immer noch ungewiss, ob der neue Vertrag den Ratifizierungsprozess in 27 Ländern überstehen wird.
Wir glauben jedoch, dass die verstärkte Anwendung der qualifizierten Mehrheitsabstimmung durch die Mitgliedsregierungen, die in den neuen Vertrag aufgenommen wurde, auch für den Ratifizierungsprozess selbst gelten sollte. Falls eine kleine Minderheit von EU-Regierungen dann nicht in der Lage sein sollte, den Vertrag zu ratifizieren, so würde er nicht ebenso vereitelt wie 2005 sein Vorgänger, der Verfassungsvertrag.



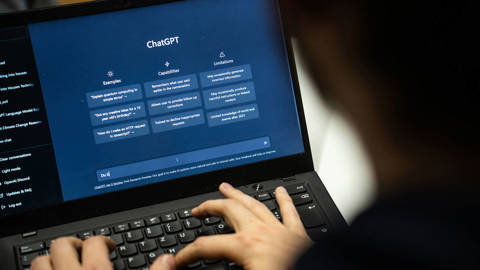






Wenn Europas Staats- und Regierungschefs sich in Portugal versammeln um einem neuen, schlankeren Reformvertrag den letzten Schliff zu geben, so könnte es hilfreich sein, wenn sie alle so tun, als hätten die letzten 50 Jahre europäische Integration nie stattgefunden. Stellen wir uns einmal vor, was Europa tun muss, um seine dringendsten Aufgaben in Angriff zunehmen, insbesondere wenn es dies ohne die politischen Beschränkungen machen könnte, die sich aus 50 Jahren EU-Geschichte ergeben, in denen Übereinkünfte ausgehandelt und marode Institutionen errichtet wurden.
Lassen Sie uns außerdem diese Fantasiereise ausweiten und annehmen, obwohl wir bei diesem EU-Szenario im „Jahre null“ nicht auf ein halbes Jahrhundert der intereuropäischen Kooperation zurückgreifen könnten, dass die Nationen, aus denen die EU derzeit besteht, trotzdem darauf aus wären, weitreichende gemeinsame Beschlüsse zu fassen.
Legen wir also unsere Zweifel ab, und versuchen wir uns vorzustellen, was Europa tun könnte und sollte, um einige der tiefgreifendsten und schwierigsten politischen Herausforderungen zu meistern, die darüber entscheiden werden, ob die nächsten 50 Jahre so konstruktiv sein werden wie die letzten. Anders ausgedrückt: Sehen wir uns unsere Probleme vor dem Hintergrund der bestehenden Mechanismen und dem Potenzial der EU an, weitreichende, neue politische Maßnahmen zu beschließen, und dann wollen wir uns fragen, warum die EU ihr eigenes Potenzial nicht nutzt und diese Leistung nicht erbringt.
Im Großen und Ganzen gibt es drei Bereiche, in denen die europäischen Politiker sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene ihre Sache besser machen können: globale Aufgaben, bei denen Europa aktiver die Führung übernehmen könnte; die Schaffung und Stärkung von Humankapital innerhalb der EU und weltweit; und die Verbesserung der Effektivität der politischen EU-Maschinerie selbst.
Europa braucht eine klarere globale Agenda mit stärkerem Profil. Es muss seine Führungsrolle in der Klimapolitik beträchtlich ausbauen, indem es sich wesentlich strengere EU-Ziele setzt und dann seinen Einfluss in der internationalen Wirtschaft und im Handel nutzt, um für neue weltweite Emissionsnormen einzutreten, die vom wissenschaftlichen Standpunkt aus als sinnvoll gelten.
In Konflikt- und Sicherheitsfragen sollte Europa in eine neue Phase eintreten, in der es bei unterschiedlichen Problemen klarer und eindeutiger Position bezieht, angefangen bei der Verbreitung von Atomwaffen bis hin zu Sanktionen gegen das Militärregime in Birma. Europa sollte sich dadurch als starken und gerechten Akteur auf der Weltbühne etablieren anstatt als „allgemeine Kirche“, in der verschiedene Sichtweisen nebeneinander existieren.
SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.
Subscribe Now
Das Ziel sollte sein, Instrumente der „Soft Power“ (sanfte Macht), wie die EU-Entwicklungshilfe und wirtschaftliche Partnerschaften, mit einem wachsenden Gefühl für Europas politische und sicherheitsstrategische Reichweite zu verbinden, um sicherzustellen, dass mit Europa als globalem Player gerechnet werden kann. Das bedeutet natürlich, dass die EU versuchen sollte, ihr transatlantisches Denken auszuweiten, damit die EU und die Vereinigten Staaten in einer Welt, in der sie gemeinsam kaum mehr als 10 % der Gesamtbevölkerung ausmachen, bei der Definition – und somit auch beim Schutz – ihrer gemeinsamen Interessen enger zusammenarbeiten.
Diese Punkte sind weit davon entfernt, eine allgemeine Kritik an den Bemühungen der EU um eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu sein. Doch sollen sie unterstreichen, was viele Menschen in Europa sehr wohl wissen, nämlich dass das Tempo, mit dem die Probleme in der internationalen Entwicklung und bei Konflikten wachsen, bisher bei weitem schneller ist als die politischen Antworten der EU darauf.
Der Aufbau von mehr Humankapital in Europa und weltweit ist ein ungemein wichtiger Bestandteil der zukünftigen EU-Aktivitäten. Bildung ist die bei weitem profitabelste Investition für Europa, also sollte es die ehrgeizigste Strategie aller Zeiten starten, um eine neue Wissensdynamik und Arbeitsplätze in der EU zu schaffen, während es gleichzeitig dazu beiträgt, die Bildung in den ärmsten Ländern der Welt stark zu verbessern.
Europa muss auch endlich den Stier der Einwanderungspolitik bei den Hörnern packen – ein Problem, das Generationen von führenden Politikern immer wieder entgangen ist. EU-weite Einwanderungsbestimmungen müssen beschlossen werden, um den Hunger des schrumpfenden Europas nach importierten Arbeitskräften mit der weit verbreiteten Angst vor interkulturellen Spannungen und gesellschaftlichen Unruhen in Einklang zu bringen. Es wird nicht einfach sein, ein gerechteres und multikulturelleres Europa zu schaffen, doch wenn dieses Problem nicht offen angesprochen wird, ist der Preis umso höher.
Aus demselben Grund sollten die europäischen Regierungen entschlossen einen neuen Versuch unternehmen, den Sinn der Europäer für ihre gemeinsame Geschichte und gemeinsamen Werte zu stärken. Eine stärkere europäische Identität ist die beste Grundlage zur Schaffung einer multikulturelleren Gesellschaft, die Demographen für unausweichlich halten.
Unterdessen ist die politische und institutionelle Maschinerie, die die EU für die Umsetzung dieser und anderer ehrgeiziger Ziele benötigt, immer noch von Zweifeln umgeben. Die Einigung auf einen Reformvertrag zur Überarbeitung der Entscheidungsmechanismen in der EU wurde Mitte des Jahres mit erleichtertem Aufatmen begrüßt, doch ist immer noch ungewiss, ob der neue Vertrag den Ratifizierungsprozess in 27 Ländern überstehen wird.
Wir glauben jedoch, dass die verstärkte Anwendung der qualifizierten Mehrheitsabstimmung durch die Mitgliedsregierungen, die in den neuen Vertrag aufgenommen wurde, auch für den Ratifizierungsprozess selbst gelten sollte. Falls eine kleine Minderheit von EU-Regierungen dann nicht in der Lage sein sollte, den Vertrag zu ratifizieren, so würde er nicht ebenso vereitelt wie 2005 sein Vorgänger, der Verfassungsvertrag.