NEW YORK – Frankreich ist eines der wenigen Länder, die Gesetze gegen Cybermobbing erlassen haben, darunter auch gegen die Drangsalierung von Journalisten. Ändere täten gut daran, es ihm gleichzutun.
Die Online-Drangsalierung von Journalisten ist ein wachsendes Problem. Oft richtet sie sich gegen Journalisten, die über Internettrolle, rassistische Gruppen und andere eklige Flecken im düsteren Teil des Webs schreiben. Besonders gefährdet sind Journalistinnen – vor allem, wenn sie männlich besetzte Themen wie Sport abdecken, sagt Sarah Guinee, die als Patti-Birch-Stipendiatin für Geschlechterfragen und Medienfreiheit des Committee to Protect Journalists mit Sitz in New York über Online-Belästigung recherchiert hat.
Im Allgemeinen neigen Journalistenverbände und Verteidiger der freien Meinungsäußerung dazu, dem CEO von Facebook, Mark Zuckerberg, zuzustimmen, dass auf einem „Markt der Ideen“ alle Ideen auf den Tisch kommen sollten und die besten davon sich durchsetzen werden. Anders ausgedrückt: Wir sollten schlechte Informationen und Ideen mit besseren Informationen und Ideen bekämpfen.
Doch das durch die französische Gesetzgebung angesprochene Online-Verhalten geht weit über den normalen Austausch von Informationen und Ideen hinaus. Zunächst einmal bewirkt die schiere Menge feindseliger Äußerungen, dass ein großer Teil der Online-Äußerungen, die gehört werden sollten, untergehen. Zudem nutzen Online-Belästiger häufig andere Taktiken als die, die offline Verwendung finden. Digitale Belästigung kann Doxing (die Veröffentlichung der Privatanschrift oder anderer personenbezogener Informationen einer anderen Person online), Pile-ons (bei denen große Gruppen eine einzelne Person attackieren), die Verbreitung verstörender Bilder, Rachepornos, Aktivitäten unter dem Namen des Opfers und Cyberstalking umfassen.
In vielen Ländern wird Journalisten, die Belästigungen ausgesetzt sind, einfach geraten, diese zu ignorieren oder ihre Peiniger zur Anzeige zu bringen. Doch Letzteres kostet Zeit und Kraft und kann zu Gegenreaktionen führen. Zwar haben Journalisten wie Gustavo Gorriti in Peru und Anton Harber und Thandeka Gqubele in Südafrika nach Online-Missbrauch Klagen wegen übler Nachrede angestrengt. Zumeist jedoch üben Medienvertreter, die Opfer von Online-Belästigung werden, Selbstzensur.
Wenn der Markt der Ideen nicht ordnungsgemäß funktioniert – so wie das derzeit online der Fall ist –, ist eine Regulierung erforderlich. Die die Politik umtreibende Frage dabei ist, ob bestehende Gesetze ausreichen, um der Online-Belästigung beizukommen. In einem Bericht aus dem Jahr 2019 kommen die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und das International Press Institute zu dem Schluss, dass sich Journalisten auf zielgerichtete Cybergesetze stützen können sollten, die im Falle von Online-Angriffen „rasche, preiswerte und wenig belastende Abhilfe“ ermöglichen.
Frankreich ist anderen Ländern hierbei voraus. Im Jahr 2014 definierte französisches Recht erstmals den Begriff der Online-Belästigung; bis dahin wurden derartige Fälle auf dieselbe Weise behandelt wie Fälle von Offline-Belästigung. Und 2018 schloss ein Gesetz gegen sexuelle und sexistische Gewalt die meisten Gesetzeslücken in Bezug auf Cybermobbing, indem es dessen rechtliche Definition ausweitete. Daher schützt französisches Recht inzwischen alle Bürger, einschließlich von Journalisten, vor Doxing, Verleumdung, Beleidigung und On-und Offline-Belästigungen. Obwohl Frankreichs Verfassungsgericht vor kurzem gegen das Gesetz urteilte, ließ es den Teil intakt, der einen für Online-Verbrechen einschließlich von Online-Belästigung zuständigen Sonderstaatsanwalt schuf.
Die Auswirkungen der französischen Gesetzgebung reichen über die Grenzen des Landes hinaus, weil die neuen Gesetze es Journalisten und anderen erleichtern, in Europa Klagen wegen Cybermobbings anzustrengen. Ganz allgemein vertritt Europa eine weiter gefasste Sicht als die USA davon, welche Art Äußerungen bestraft werden können, und verteidigt die Rechte des Einzelnen auf Privatsphäre entschiedener. Weil in Europa Klagen wegen Angriffen auf die Reputation oder Glaubwürdigkeit einer Person erhoben werden können, sind Journalisten dort in dieser Hinsicht besser geschützt als ihre Kollegen in den USA und anderen Teilen der Welt.
Der Fall der Lyoner Journalistin Julie Hainaut zeigt, wie Frankreichs Gesetze gegen Cybermobbing gegen Belästiger genutzt werden können. Nachdem sie berichtet hatte, dass die Eigentümer von „La Première Plantation“, einer 2017 in der Stadt eröffneten Bar mit Kolonialthema, sich zustimmend über die Kolonialzeit geäußert hatten, wurde Hainaut online gemobbt, und ihre persönlichen Daten wurden im Web öffentlich gemacht. Nachdem sie in zwei Jahren bei vier verschiedenen Gelegenheiten Anzeige erstattet hatte, gingen die französischen Behörden endlich strafrechtlich gegen die Belästiger vor. Ende 2019 wurde einer von ihnen zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe von insgesamt 7.000 Euro verurteilt. (Der Täter hat Berufung eingelegt.)
„Das Rechtssystem im Bereich der üblen Nachrede und des Mobbings ist sehr gescheit konzipiert, denn es schützt die freie Rede und stellt sicher, dass Journalisten sich gegen Trolle und Belästiger zur Wehr setzen können“, erklärte mir kürzlich Paul Coppin, Justiziar der Gruppe Reporters sans frontières (Reporter ohne Grenzen) mit Sitz in Paris. „Jedoch brauchen wir noch immer ein Sensibilisierungstraining für Polizei und Justiz, da viele dort die Auswirkungen von Online-Belästigung auf die Opfer nicht völlig erfassen und nicht bereit sind, Anzeigen so schnell und so ernsthaft zu verfolgen, wie sie das tun sollten.“
Die großen Technologieunternehmen sind weder bereit noch in der Lage, selbst etwas gegen das Problem des Cybermobbings zu tun. Die Ernennung eines Sonderstaatsanwalts für Online-Verbrechen in Frankreich spiegelt das Anerkenntnis dieser Tatsache wider. Indem sie Frankreichs Beispiel folgen und neue Gesetze verabschieden, könnten die Politiker Journalisten und anderen gefährdeten Gruppen helfen, sich auch anderswo gegen Online-Missbrauch zur Wehr zu setzen.
Aus dem Englischen von Jan Doolan





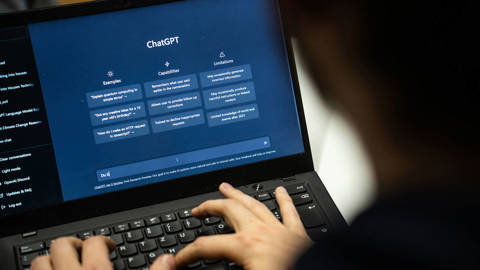






NEW YORK – Frankreich ist eines der wenigen Länder, die Gesetze gegen Cybermobbing erlassen haben, darunter auch gegen die Drangsalierung von Journalisten. Ändere täten gut daran, es ihm gleichzutun.
Die Online-Drangsalierung von Journalisten ist ein wachsendes Problem. Oft richtet sie sich gegen Journalisten, die über Internettrolle, rassistische Gruppen und andere eklige Flecken im düsteren Teil des Webs schreiben. Besonders gefährdet sind Journalistinnen – vor allem, wenn sie männlich besetzte Themen wie Sport abdecken, sagt Sarah Guinee, die als Patti-Birch-Stipendiatin für Geschlechterfragen und Medienfreiheit des Committee to Protect Journalists mit Sitz in New York über Online-Belästigung recherchiert hat.
Im Allgemeinen neigen Journalistenverbände und Verteidiger der freien Meinungsäußerung dazu, dem CEO von Facebook, Mark Zuckerberg, zuzustimmen, dass auf einem „Markt der Ideen“ alle Ideen auf den Tisch kommen sollten und die besten davon sich durchsetzen werden. Anders ausgedrückt: Wir sollten schlechte Informationen und Ideen mit besseren Informationen und Ideen bekämpfen.
Doch das durch die französische Gesetzgebung angesprochene Online-Verhalten geht weit über den normalen Austausch von Informationen und Ideen hinaus. Zunächst einmal bewirkt die schiere Menge feindseliger Äußerungen, dass ein großer Teil der Online-Äußerungen, die gehört werden sollten, untergehen. Zudem nutzen Online-Belästiger häufig andere Taktiken als die, die offline Verwendung finden. Digitale Belästigung kann Doxing (die Veröffentlichung der Privatanschrift oder anderer personenbezogener Informationen einer anderen Person online), Pile-ons (bei denen große Gruppen eine einzelne Person attackieren), die Verbreitung verstörender Bilder, Rachepornos, Aktivitäten unter dem Namen des Opfers und Cyberstalking umfassen.
In vielen Ländern wird Journalisten, die Belästigungen ausgesetzt sind, einfach geraten, diese zu ignorieren oder ihre Peiniger zur Anzeige zu bringen. Doch Letzteres kostet Zeit und Kraft und kann zu Gegenreaktionen führen. Zwar haben Journalisten wie Gustavo Gorriti in Peru und Anton Harber und Thandeka Gqubele in Südafrika nach Online-Missbrauch Klagen wegen übler Nachrede angestrengt. Zumeist jedoch üben Medienvertreter, die Opfer von Online-Belästigung werden, Selbstzensur.
Wenn der Markt der Ideen nicht ordnungsgemäß funktioniert – so wie das derzeit online der Fall ist –, ist eine Regulierung erforderlich. Die die Politik umtreibende Frage dabei ist, ob bestehende Gesetze ausreichen, um der Online-Belästigung beizukommen. In einem Bericht aus dem Jahr 2019 kommen die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und das International Press Institute zu dem Schluss, dass sich Journalisten auf zielgerichtete Cybergesetze stützen können sollten, die im Falle von Online-Angriffen „rasche, preiswerte und wenig belastende Abhilfe“ ermöglichen.
SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.
Subscribe Now
Frankreich ist anderen Ländern hierbei voraus. Im Jahr 2014 definierte französisches Recht erstmals den Begriff der Online-Belästigung; bis dahin wurden derartige Fälle auf dieselbe Weise behandelt wie Fälle von Offline-Belästigung. Und 2018 schloss ein Gesetz gegen sexuelle und sexistische Gewalt die meisten Gesetzeslücken in Bezug auf Cybermobbing, indem es dessen rechtliche Definition ausweitete. Daher schützt französisches Recht inzwischen alle Bürger, einschließlich von Journalisten, vor Doxing, Verleumdung, Beleidigung und On-und Offline-Belästigungen. Obwohl Frankreichs Verfassungsgericht vor kurzem gegen das Gesetz urteilte, ließ es den Teil intakt, der einen für Online-Verbrechen einschließlich von Online-Belästigung zuständigen Sonderstaatsanwalt schuf.
Die Auswirkungen der französischen Gesetzgebung reichen über die Grenzen des Landes hinaus, weil die neuen Gesetze es Journalisten und anderen erleichtern, in Europa Klagen wegen Cybermobbings anzustrengen. Ganz allgemein vertritt Europa eine weiter gefasste Sicht als die USA davon, welche Art Äußerungen bestraft werden können, und verteidigt die Rechte des Einzelnen auf Privatsphäre entschiedener. Weil in Europa Klagen wegen Angriffen auf die Reputation oder Glaubwürdigkeit einer Person erhoben werden können, sind Journalisten dort in dieser Hinsicht besser geschützt als ihre Kollegen in den USA und anderen Teilen der Welt.
Der Fall der Lyoner Journalistin Julie Hainaut zeigt, wie Frankreichs Gesetze gegen Cybermobbing gegen Belästiger genutzt werden können. Nachdem sie berichtet hatte, dass die Eigentümer von „La Première Plantation“, einer 2017 in der Stadt eröffneten Bar mit Kolonialthema, sich zustimmend über die Kolonialzeit geäußert hatten, wurde Hainaut online gemobbt, und ihre persönlichen Daten wurden im Web öffentlich gemacht. Nachdem sie in zwei Jahren bei vier verschiedenen Gelegenheiten Anzeige erstattet hatte, gingen die französischen Behörden endlich strafrechtlich gegen die Belästiger vor. Ende 2019 wurde einer von ihnen zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe von insgesamt 7.000 Euro verurteilt. (Der Täter hat Berufung eingelegt.)
„Das Rechtssystem im Bereich der üblen Nachrede und des Mobbings ist sehr gescheit konzipiert, denn es schützt die freie Rede und stellt sicher, dass Journalisten sich gegen Trolle und Belästiger zur Wehr setzen können“, erklärte mir kürzlich Paul Coppin, Justiziar der Gruppe Reporters sans frontières (Reporter ohne Grenzen) mit Sitz in Paris. „Jedoch brauchen wir noch immer ein Sensibilisierungstraining für Polizei und Justiz, da viele dort die Auswirkungen von Online-Belästigung auf die Opfer nicht völlig erfassen und nicht bereit sind, Anzeigen so schnell und so ernsthaft zu verfolgen, wie sie das tun sollten.“
Die großen Technologieunternehmen sind weder bereit noch in der Lage, selbst etwas gegen das Problem des Cybermobbings zu tun. Die Ernennung eines Sonderstaatsanwalts für Online-Verbrechen in Frankreich spiegelt das Anerkenntnis dieser Tatsache wider. Indem sie Frankreichs Beispiel folgen und neue Gesetze verabschieden, könnten die Politiker Journalisten und anderen gefährdeten Gruppen helfen, sich auch anderswo gegen Online-Missbrauch zur Wehr zu setzen.
Aus dem Englischen von Jan Doolan