NEW YORK – Es ist leicht, sich über die College-Demonstranten in den Vereinigten Staaten, die ein freies Palästina „vom Fluss bis zum Meer“ fordern, lustig zu machen. An einigen der teuersten und renommiertesten Universitäten tragen Studenten Palästinensertücher, „befreien“ als vermeintliche Freiheitskämpfer den Campus – und einige von ihnen fordern von der Universitätsverwaltung sogar „grundlegende humanitäre Hilfe“ in Form von Verpflegung und Wasser.
Politische Demonstrationen sind natürlich immer auch eine Art von Theater. Sicherlich sollten wir nicht alle verspotten, die gegen die Ermordung der vielen unschuldigen Zivilisten in Gaza demonstrieren. Und ihnen mit Gewalt zu begegnen – ob durch die Polizei, oder wie an der UCLA, durch einen maskierten Pöbel – ist inakzeptabel.
Das Problem ist, dass die „antizionistische“ Sache, die an den Unis immer stärker vertreten wird, häufig inkohärent ist: Sie beruht auf der ideologischen Grundlage, dass alles miteinander verbunden ist: die Polizeibrutalität gegen Afroamerikaner, die globale Erwärmung, der US-Imperialismus, die Bewegung der Überlegenheit der weißen Rasse, die Geschichte der amerikanischen Sklaverei, der europäische Kolonialismus, die Trans- und Homophobie („Queers for Palestine“), und jetzt der Krieg zwischen Israel und der Hamas. In einem Interview der New York Times an der Cornell-Universität hieß es, die „Klimagerechtigkeit“ beruhe auf „demselben Kampf wie gegen den Imperialismus, den Kapitalismus – gegen solche Dinge. Ich denke, das trifft eindeutig auch auf den Völkermord in Palästina zu.“
Der Zionismus, eine vielfältige jüdisch-nationalistische Bewegung mit religiösen, säkularen, linken und rechten Elementen, ist nun zu einem Synonym für Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus geworden. Und als guter, humaner und moralischer Mensch müsse man, so wird geglaubt, ein „Antizionist“ sein.
Manche meinen, diese Einstellung sei auch antisemitisch, aber dies ist nicht immer klar. Lehnt man den Zionismus ab oder kritisiert man die israelische Politik, ist man nicht notwendigerweise ein Antisemit. Spricht man aber Israel das Existenzrecht ab, ist das sicherlich feindselig – ebenso wie die Annahme, alle Juden seien Zionisten.
Dafür, alle Arten von Unterdrückung miteinander in Verbindung zu bringen, gibt es sogar einen eigenen akademischen Begriff: „Intersektionalität“. Viele Studenten, die momentan für Palästina demonstrieren, haben sich diese Denkweise angeeignet, weil sie ihnen beigebracht wurde – meist von Professoren derselben Institute, gegen die nun demonstriert wird.
Die vielen konkurrierenden identitätspolitischen Strömungen haben eine Gemeinsamkeit, auf die sich alle gebildeten liberalen Linken, insbesondere in den USA, einigen können: die Annahme, um als Bürger im postkolonialistischen Zeitalter die richtige Einstellung zu haben, müsse man sich aktiv antirassistisch, antiimperialistisch und antikolonialistisch engagieren. Dazu müssen alle vergangenen und gegenwärtigen Ereignisse auf der Welt durch diese Brille betrachtet werden – darunter auch die vielschichtigen Konflikte in den USA und im Nahen Osten.
Diese Weltanschauung kann erklären, warum die propalästinensischen Demonstrationen an einigen der exklusivsten amerikanischen Universitäten begannen: Columbia, Harvard, Yale und Stanford. Intersektionalität ist kein Merkmal der Arbeiterklasse, sondern der gut ausgebildeten Elite, die sich für das kollektive moralische Gewissen der westlichen Welt hält.
Der zunehmende Aktivismus auf dem Campus könnte teilweise daran liegen, dass die Mitglieder dieser Elite Schuldgefühle haben, weil sie die teuersten Universitäten besuchen können – insbesondere in einer Gesellschaft, in der die Spaltung zwischen Reich und Arm zunimmt. Mit Privilegien leben zu können ist leichter, wenn der Klassenkampf durch Proteste gegen Kolonialismus und Rassismus ersetzt wird.
Allerdings spielt auch hier die Klasse eine gewissen Rolle: Rebellionen entstehen häufig aus der Angst, Privilegien zu verlieren. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wendet sich mit seiner Demagogie an relativ schlecht ausgebildete Weiße, die fürchten, von Einwanderern übertroffen zu werden. Ähnliches geschieht auch an den elitären amerikanischen Institutionen und in anderen Teilen der westlichen Welt.
Ein weißer Mann aus einer gebildeten Familie zu sein, kam bis vor kurzem meist einem Freifahrschein in die obersten Schichten der Gesellschaft gleich. Aber um die beliebtesten Arbeitsplätze bei Hochschulen, Verlagen, Museen, Zeitungen und anderen Einrichtungen konkurrieren nun zunehmend auch hoch qualifizierte Farbige und Frauen. Diese Entwicklung ist absolut positiv. Alle, die an Inklusion, Diversität und – nicht zuletzt – Intersektionalität glauben, sollten sich darüber freuen.
Aber die linksliberale Ideologie, die auf aktive „Dekolonialisierung“ und das rituelle Eingeständnis rassischer Privilegien besteht, kann zu Abwehrreaktionen führen: Immer mehr junge weiße Männer in Europa und den USA gehen rechtsextremen Parteien und cleveren Führerfiguren auf den Leim, die ihnen beibringen wollen, wie sie ihre Maskulinität bestätigen und Frauen wieder in ihre Schranken weisen können. Dass diese Bewegung auch Vorurteile gegen farbige Menschen für sich nutzt, ist offensichtlich.
Die Angst der Elite um ihre Privilegien kann aber auch in die andere Richtung führen: Studentinnen und Studenten der teuersten Privatuniversitäten glauben, es sei in ihrem Interesse, sich so intersektional, antirassistisch, antiimperialistisch und antikolonialistisch zu verhalten, dass sie damit die Minderheiten noch übertreffen. Dies soll dazu dienen, dass sie in den intellektuellen und kulturellen Sphären ihre Führungspositionen behalten.
Vielleicht haben Studenten und Mitarbeiter der Columbia University deshalb als erste gegen den israelischen Krieg in Gaza demonstriert – schnell gefolgt von Aktivisten anderer Eliteschulen. Ob dies wirklich dazu beiträgt, dass die Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen, in dem sie unter einer frei gewählten Regierung besser und würdevoller leben können, sei dahingestellt. Aber vielleicht war dies nie der zentrale Punkt. Wie es bei amerikanischen Protestbewegungen häufig der Fall ist, könnte es auch hier hauptsächlich um die USA gehen.
Aus dem Englischen von Harald Eckhoff





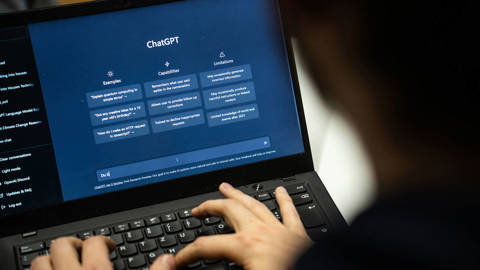






NEW YORK – Es ist leicht, sich über die College-Demonstranten in den Vereinigten Staaten, die ein freies Palästina „vom Fluss bis zum Meer“ fordern, lustig zu machen. An einigen der teuersten und renommiertesten Universitäten tragen Studenten Palästinensertücher, „befreien“ als vermeintliche Freiheitskämpfer den Campus – und einige von ihnen fordern von der Universitätsverwaltung sogar „grundlegende humanitäre Hilfe“ in Form von Verpflegung und Wasser.
Politische Demonstrationen sind natürlich immer auch eine Art von Theater. Sicherlich sollten wir nicht alle verspotten, die gegen die Ermordung der vielen unschuldigen Zivilisten in Gaza demonstrieren. Und ihnen mit Gewalt zu begegnen – ob durch die Polizei, oder wie an der UCLA, durch einen maskierten Pöbel – ist inakzeptabel.
Das Problem ist, dass die „antizionistische“ Sache, die an den Unis immer stärker vertreten wird, häufig inkohärent ist: Sie beruht auf der ideologischen Grundlage, dass alles miteinander verbunden ist: die Polizeibrutalität gegen Afroamerikaner, die globale Erwärmung, der US-Imperialismus, die Bewegung der Überlegenheit der weißen Rasse, die Geschichte der amerikanischen Sklaverei, der europäische Kolonialismus, die Trans- und Homophobie („Queers for Palestine“), und jetzt der Krieg zwischen Israel und der Hamas. In einem Interview der New York Times an der Cornell-Universität hieß es, die „Klimagerechtigkeit“ beruhe auf „demselben Kampf wie gegen den Imperialismus, den Kapitalismus – gegen solche Dinge. Ich denke, das trifft eindeutig auch auf den Völkermord in Palästina zu.“
Der Zionismus, eine vielfältige jüdisch-nationalistische Bewegung mit religiösen, säkularen, linken und rechten Elementen, ist nun zu einem Synonym für Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus geworden. Und als guter, humaner und moralischer Mensch müsse man, so wird geglaubt, ein „Antizionist“ sein.
Manche meinen, diese Einstellung sei auch antisemitisch, aber dies ist nicht immer klar. Lehnt man den Zionismus ab oder kritisiert man die israelische Politik, ist man nicht notwendigerweise ein Antisemit. Spricht man aber Israel das Existenzrecht ab, ist das sicherlich feindselig – ebenso wie die Annahme, alle Juden seien Zionisten.
Dafür, alle Arten von Unterdrückung miteinander in Verbindung zu bringen, gibt es sogar einen eigenen akademischen Begriff: „Intersektionalität“. Viele Studenten, die momentan für Palästina demonstrieren, haben sich diese Denkweise angeeignet, weil sie ihnen beigebracht wurde – meist von Professoren derselben Institute, gegen die nun demonstriert wird.
SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.
Subscribe Now
Die vielen konkurrierenden identitätspolitischen Strömungen haben eine Gemeinsamkeit, auf die sich alle gebildeten liberalen Linken, insbesondere in den USA, einigen können: die Annahme, um als Bürger im postkolonialistischen Zeitalter die richtige Einstellung zu haben, müsse man sich aktiv antirassistisch, antiimperialistisch und antikolonialistisch engagieren. Dazu müssen alle vergangenen und gegenwärtigen Ereignisse auf der Welt durch diese Brille betrachtet werden – darunter auch die vielschichtigen Konflikte in den USA und im Nahen Osten.
Diese Weltanschauung kann erklären, warum die propalästinensischen Demonstrationen an einigen der exklusivsten amerikanischen Universitäten begannen: Columbia, Harvard, Yale und Stanford. Intersektionalität ist kein Merkmal der Arbeiterklasse, sondern der gut ausgebildeten Elite, die sich für das kollektive moralische Gewissen der westlichen Welt hält.
Der zunehmende Aktivismus auf dem Campus könnte teilweise daran liegen, dass die Mitglieder dieser Elite Schuldgefühle haben, weil sie die teuersten Universitäten besuchen können – insbesondere in einer Gesellschaft, in der die Spaltung zwischen Reich und Arm zunimmt. Mit Privilegien leben zu können ist leichter, wenn der Klassenkampf durch Proteste gegen Kolonialismus und Rassismus ersetzt wird.
Allerdings spielt auch hier die Klasse eine gewissen Rolle: Rebellionen entstehen häufig aus der Angst, Privilegien zu verlieren. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wendet sich mit seiner Demagogie an relativ schlecht ausgebildete Weiße, die fürchten, von Einwanderern übertroffen zu werden. Ähnliches geschieht auch an den elitären amerikanischen Institutionen und in anderen Teilen der westlichen Welt.
Ein weißer Mann aus einer gebildeten Familie zu sein, kam bis vor kurzem meist einem Freifahrschein in die obersten Schichten der Gesellschaft gleich. Aber um die beliebtesten Arbeitsplätze bei Hochschulen, Verlagen, Museen, Zeitungen und anderen Einrichtungen konkurrieren nun zunehmend auch hoch qualifizierte Farbige und Frauen. Diese Entwicklung ist absolut positiv. Alle, die an Inklusion, Diversität und – nicht zuletzt – Intersektionalität glauben, sollten sich darüber freuen.
Aber die linksliberale Ideologie, die auf aktive „Dekolonialisierung“ und das rituelle Eingeständnis rassischer Privilegien besteht, kann zu Abwehrreaktionen führen: Immer mehr junge weiße Männer in Europa und den USA gehen rechtsextremen Parteien und cleveren Führerfiguren auf den Leim, die ihnen beibringen wollen, wie sie ihre Maskulinität bestätigen und Frauen wieder in ihre Schranken weisen können. Dass diese Bewegung auch Vorurteile gegen farbige Menschen für sich nutzt, ist offensichtlich.
Die Angst der Elite um ihre Privilegien kann aber auch in die andere Richtung führen: Studentinnen und Studenten der teuersten Privatuniversitäten glauben, es sei in ihrem Interesse, sich so intersektional, antirassistisch, antiimperialistisch und antikolonialistisch zu verhalten, dass sie damit die Minderheiten noch übertreffen. Dies soll dazu dienen, dass sie in den intellektuellen und kulturellen Sphären ihre Führungspositionen behalten.
Vielleicht haben Studenten und Mitarbeiter der Columbia University deshalb als erste gegen den israelischen Krieg in Gaza demonstriert – schnell gefolgt von Aktivisten anderer Eliteschulen. Ob dies wirklich dazu beiträgt, dass die Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen, in dem sie unter einer frei gewählten Regierung besser und würdevoller leben können, sei dahingestellt. Aber vielleicht war dies nie der zentrale Punkt. Wie es bei amerikanischen Protestbewegungen häufig der Fall ist, könnte es auch hier hauptsächlich um die USA gehen.
Aus dem Englischen von Harald Eckhoff