MADRID – Ende Juni – 25 Jahre, nachdem Madrid zuletzt Ausrichtungsort eines NATO-Gipfels war – wird die spanische Hauptstadt erneut die Kulisse für ein neues Kapitel der europäischen Sicherheit sein. Und dabei wird überwiegend Europa der Protagonist sein müssen. Letztlich muss das kommende Treffen des Bündnisses uns Europäern helfen, uns unserer Verantwortung für die Sicherheit unseren Kontinents zu stellen. Das ist der beste und notwendigste Beitrag, den Europa zur Zukunft der NATO leisten kann.
Der heutige geopolitische Kontext unterscheidet sich stark von dem vor einem Vierteljahrhundert. Auf dem Madrider Gipfel 1997 lud die NATO drei ehemalige Warschauer-Pakt-Staaten – die Tschechische Republik, Ungarn und Polen – zum Beitritt ein. Zudem sah Europa in jenem Jahr nach der Unterzeichnung der NATO-Russland-Grundakte und der anschließenden Gründung des NATO-Russland-Rates einer Zukunft beispielloser Aussöhnung mit dem Kreml entgegen. Inzwischen ist von diesem Optimismus natürlich nicht viel übriggeblieben.
Die NATO hat sich als unverzichtbar für Europas Sicherheit und als beste Garantie für die nationale Sicherheit einer wachsenden Anzahl von Ländern erwiesen. Eine der wichtigsten Folgen des Kriegs in der Ukraine sind Finnlands und Schwedens Anträge auf Beitritt zur NATO. Beides sind Länder, die alle Eigenschaften mitbringen, einen positiven Beitrag zum Bündnis zu leisten. Im Gefolge der jüngsten Entscheidung der Bürger Dänemarks für den Beitritt zur EU-Verteidigungspolitik nähern sich die Institutionen, die die Basis der europäischen Sicherheit bilden, einander zunehmend an.
Jahrzehntelang hat eine falsche Dichotomie zwischen Befürwortern des europäischen Einheitsgedanken und Atlantikern eine sterile und unproduktive Sicherheitsdebatte in Europa angeheizt. Heute bezweifelt kaum jemand, dass die Europäer mehr zum Bündnis und zur europäischen Sicherheit betragen müssen und dass sie die Fähigkeit entwickeln sollten, bei künftigen Sicherheitskrisen eine Führungsrolle zu übernehmen. Die Frage ist daher, wie Europa am besten zur Mission der NATO beitragen kann.
Ein starkes Europa ist unverzichtbar zur Wiederbelebung des transatlantischen Sicherheitsbündnisses. Bei einer meiner ersten Sitzungen als Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik beschrieb ein ehemaliger britischer Verteidigungsstabschef die Richtung, die diese Beziehung nehmen sollte, ganz sachlich so: „Ein Europa, dass mit den Vereinigten Staaten lediglich aufgrund eigener Schwäche verbündet bleibt“, sagte er“, „ist von begrenztem Wert.“
Die transatlantische Beziehung zu stärken, bedeutet, anzuerkennen, dass sich ihre europäische Komponente geändert hat. Die Ereignisse der jüngsten Monate haben gezeigt, dass die EU auf Sicherheitsbedrohungen auf koordinierte und robuste Weise reagieren kann. Umfassende Sanktionen gegen Russland, eine gemeinsame Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine und die bloße Idee, Europas Abhängigkeit von russischer Energie drastisch zu verringern, wären noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen.
Nach den Maßnahmen, die der Kontinent zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 ergriffen hat, hat nun die europäische Reaktion auf Russlands Invasion der Ukraine bestätigt, dass Europa in schlechten Zeiten an Stärke gewinnt. Zwar stimmt es, dass Präsident Wladimir Putins Angriffskrieg es Europa erleichtert hat, sich zusammenzuschließen. Doch ist der Ehrgeiz seiner Regierungen angesichts der wirtschaftlichen Kosten einiger der Maßnahmen für Europa bemerkenswert.
Die Grundlage für die Stärkung der europäischen Integration in Verteidigungsfragen existiert bereits. Die Fortschritte der vergangenen 20 Jahre bei der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Erfahrungen aus zivilen und militärischen EU-Missionen, die Arbeit der Europäischen Verteidigungsagentur sowie die Verabschiedung des strategischen Kompasses haben Europa eine günstige Position verschafft, die Herausforderung in Angriff zu nehmen.
Die Bereitschaft der nationalen Bevölkerungen und der EU-Institutionen, gemeinsame Projekte zur Stärkung des europäischen Verteidigungssektors zu finanzieren, ist ein wichtiger erster Schritt. Der politische Schwenk der deutschen Bundesregierung – die 2022 ihre Verteidigungsausgaben nahezu verdoppelt hat (auf 100 Milliarden Euros) – stellt eine historische Gelegenheit dar, Projekte mit anderen europäischen Partnern zu finanzieren.
Und Deutschland ist kein Einzelfall. Der Krieg in der Ukraine hat die EU-Mitgliedstaaten veranlasst, nie dagewesene Erhöhungen ihrer Verteidigungsausgaben in der Gesamtsumme von 200 Milliarden Euro über die nächsten vier Jahre hinweg anzukündigen. Diese Zusagen stehen im Gegensatz zu Europas bisheriger Schwerfälligkeit in diesem Bereich. Während der letzten 20 Jahre betrug der prozentuelle Anstieg der gemeinsamen Verteidigungsausgaben in den EU-Mitgliedstaaten ein Drittel von dem der USA, ein Fünfzehntel von dem Russlands und ein Dreißigstel von dem Chinas.
Zum Glück ist die Höhe der Militärausgaben weniger wichtig als die Art und Weise, wie das Geld ausgegeben wird. Wir müssen es besser ausgeben, gemeinsam, und als Europäer. Gemeinsame Verteidigungsausgaben sind effizienter als nationale Bemühungen und tragen dazu bei, Europas industrielle und technologische Basis zu stärken. Die jüngste Zusage der Europäischen Kommission, 500 Millionen Euro für die gemeinsame Rüstungsbeschaffung bereitzustellen, legt nahe, dass sich Europa in die richtige Richtung bewegt.
Europa stützt sich derzeit für 60 % seiner militärischen Kapazitäten auf militärische Ausgaben außerhalb seiner Grenzen. Mehr und bessere Verteidigungsausgaben müssen es vermeiden, die Abhängigkeit Europas von der Rüstungsindustrie anderer Länder zu vergrößern, da dies die Bemühungen untergraben würde, eine stärkere europäische strategische Autonomie zu erreichen. Doch während wir zu Investitionen in eine komplett europäische Rüstungsindustrie ermutigen sollten, darf die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagene Europäische Verteidigungsunion keine neuen internen Abhängigkeiten hervorbringen, von denen einige wenige nationale Industrien innerhalb Europas profitieren.
Die Entwicklung der gemeinsamen Verteidigungspolitik der EU sieht weder eine Aufteilung der Verantwortlichkeiten in Bezug auf die europäische Sicherheit vor noch gibt sie vor, die lebenswichtige von der NATO erfüllte Funktion zu ersetzen. Die Verantwortlichkeiten der Organisationen, die die Basis für das transatlantische Sicherheitsbündnis bilden, werden dieselben bleiben. Was wichtig ist, ist, diese Verantwortlichkeiten mit all unseren bestehenden Kapazitäten in Angriff zu nehmen.
Der amerikanische Kommentator Walter Lippmann hat einmal gesagt, Bündnisse seien wie Ketten: nur so stark wie ihr schwächstes Glieder. Im Vorfeld des Madrider NATO-Gipfels 2022 ist dies der beste Weg, die politische Herausforderung zu beschreiben, vor denen die transatlantische Beziehung steht. Nur der politische Wille der Europäer und ihrer Regierungen kann die Sicherheit unseres Kontinents stärken.
Aus dem Englischen von Jan Doolan





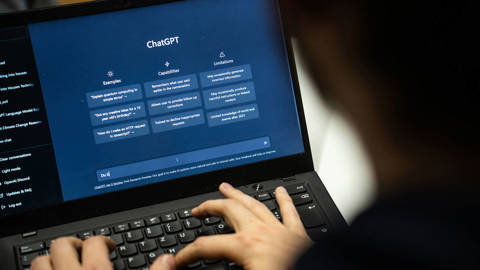






MADRID – Ende Juni – 25 Jahre, nachdem Madrid zuletzt Ausrichtungsort eines NATO-Gipfels war – wird die spanische Hauptstadt erneut die Kulisse für ein neues Kapitel der europäischen Sicherheit sein. Und dabei wird überwiegend Europa der Protagonist sein müssen. Letztlich muss das kommende Treffen des Bündnisses uns Europäern helfen, uns unserer Verantwortung für die Sicherheit unseren Kontinents zu stellen. Das ist der beste und notwendigste Beitrag, den Europa zur Zukunft der NATO leisten kann.
Der heutige geopolitische Kontext unterscheidet sich stark von dem vor einem Vierteljahrhundert. Auf dem Madrider Gipfel 1997 lud die NATO drei ehemalige Warschauer-Pakt-Staaten – die Tschechische Republik, Ungarn und Polen – zum Beitritt ein. Zudem sah Europa in jenem Jahr nach der Unterzeichnung der NATO-Russland-Grundakte und der anschließenden Gründung des NATO-Russland-Rates einer Zukunft beispielloser Aussöhnung mit dem Kreml entgegen. Inzwischen ist von diesem Optimismus natürlich nicht viel übriggeblieben.
Die NATO hat sich als unverzichtbar für Europas Sicherheit und als beste Garantie für die nationale Sicherheit einer wachsenden Anzahl von Ländern erwiesen. Eine der wichtigsten Folgen des Kriegs in der Ukraine sind Finnlands und Schwedens Anträge auf Beitritt zur NATO. Beides sind Länder, die alle Eigenschaften mitbringen, einen positiven Beitrag zum Bündnis zu leisten. Im Gefolge der jüngsten Entscheidung der Bürger Dänemarks für den Beitritt zur EU-Verteidigungspolitik nähern sich die Institutionen, die die Basis der europäischen Sicherheit bilden, einander zunehmend an.
Jahrzehntelang hat eine falsche Dichotomie zwischen Befürwortern des europäischen Einheitsgedanken und Atlantikern eine sterile und unproduktive Sicherheitsdebatte in Europa angeheizt. Heute bezweifelt kaum jemand, dass die Europäer mehr zum Bündnis und zur europäischen Sicherheit betragen müssen und dass sie die Fähigkeit entwickeln sollten, bei künftigen Sicherheitskrisen eine Führungsrolle zu übernehmen. Die Frage ist daher, wie Europa am besten zur Mission der NATO beitragen kann.
Ein starkes Europa ist unverzichtbar zur Wiederbelebung des transatlantischen Sicherheitsbündnisses. Bei einer meiner ersten Sitzungen als Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik beschrieb ein ehemaliger britischer Verteidigungsstabschef die Richtung, die diese Beziehung nehmen sollte, ganz sachlich so: „Ein Europa, dass mit den Vereinigten Staaten lediglich aufgrund eigener Schwäche verbündet bleibt“, sagte er“, „ist von begrenztem Wert.“
Die transatlantische Beziehung zu stärken, bedeutet, anzuerkennen, dass sich ihre europäische Komponente geändert hat. Die Ereignisse der jüngsten Monate haben gezeigt, dass die EU auf Sicherheitsbedrohungen auf koordinierte und robuste Weise reagieren kann. Umfassende Sanktionen gegen Russland, eine gemeinsame Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine und die bloße Idee, Europas Abhängigkeit von russischer Energie drastisch zu verringern, wären noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen.
SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.
Subscribe Now
Nach den Maßnahmen, die der Kontinent zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 ergriffen hat, hat nun die europäische Reaktion auf Russlands Invasion der Ukraine bestätigt, dass Europa in schlechten Zeiten an Stärke gewinnt. Zwar stimmt es, dass Präsident Wladimir Putins Angriffskrieg es Europa erleichtert hat, sich zusammenzuschließen. Doch ist der Ehrgeiz seiner Regierungen angesichts der wirtschaftlichen Kosten einiger der Maßnahmen für Europa bemerkenswert.
Die Grundlage für die Stärkung der europäischen Integration in Verteidigungsfragen existiert bereits. Die Fortschritte der vergangenen 20 Jahre bei der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Erfahrungen aus zivilen und militärischen EU-Missionen, die Arbeit der Europäischen Verteidigungsagentur sowie die Verabschiedung des strategischen Kompasses haben Europa eine günstige Position verschafft, die Herausforderung in Angriff zu nehmen.
Die Bereitschaft der nationalen Bevölkerungen und der EU-Institutionen, gemeinsame Projekte zur Stärkung des europäischen Verteidigungssektors zu finanzieren, ist ein wichtiger erster Schritt. Der politische Schwenk der deutschen Bundesregierung – die 2022 ihre Verteidigungsausgaben nahezu verdoppelt hat (auf 100 Milliarden Euros) – stellt eine historische Gelegenheit dar, Projekte mit anderen europäischen Partnern zu finanzieren.
Und Deutschland ist kein Einzelfall. Der Krieg in der Ukraine hat die EU-Mitgliedstaaten veranlasst, nie dagewesene Erhöhungen ihrer Verteidigungsausgaben in der Gesamtsumme von 200 Milliarden Euro über die nächsten vier Jahre hinweg anzukündigen. Diese Zusagen stehen im Gegensatz zu Europas bisheriger Schwerfälligkeit in diesem Bereich. Während der letzten 20 Jahre betrug der prozentuelle Anstieg der gemeinsamen Verteidigungsausgaben in den EU-Mitgliedstaaten ein Drittel von dem der USA, ein Fünfzehntel von dem Russlands und ein Dreißigstel von dem Chinas.
Zum Glück ist die Höhe der Militärausgaben weniger wichtig als die Art und Weise, wie das Geld ausgegeben wird. Wir müssen es besser ausgeben, gemeinsam, und als Europäer. Gemeinsame Verteidigungsausgaben sind effizienter als nationale Bemühungen und tragen dazu bei, Europas industrielle und technologische Basis zu stärken. Die jüngste Zusage der Europäischen Kommission, 500 Millionen Euro für die gemeinsame Rüstungsbeschaffung bereitzustellen, legt nahe, dass sich Europa in die richtige Richtung bewegt.
Europa stützt sich derzeit für 60 % seiner militärischen Kapazitäten auf militärische Ausgaben außerhalb seiner Grenzen. Mehr und bessere Verteidigungsausgaben müssen es vermeiden, die Abhängigkeit Europas von der Rüstungsindustrie anderer Länder zu vergrößern, da dies die Bemühungen untergraben würde, eine stärkere europäische strategische Autonomie zu erreichen. Doch während wir zu Investitionen in eine komplett europäische Rüstungsindustrie ermutigen sollten, darf die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagene Europäische Verteidigungsunion keine neuen internen Abhängigkeiten hervorbringen, von denen einige wenige nationale Industrien innerhalb Europas profitieren.
Die Entwicklung der gemeinsamen Verteidigungspolitik der EU sieht weder eine Aufteilung der Verantwortlichkeiten in Bezug auf die europäische Sicherheit vor noch gibt sie vor, die lebenswichtige von der NATO erfüllte Funktion zu ersetzen. Die Verantwortlichkeiten der Organisationen, die die Basis für das transatlantische Sicherheitsbündnis bilden, werden dieselben bleiben. Was wichtig ist, ist, diese Verantwortlichkeiten mit all unseren bestehenden Kapazitäten in Angriff zu nehmen.
Der amerikanische Kommentator Walter Lippmann hat einmal gesagt, Bündnisse seien wie Ketten: nur so stark wie ihr schwächstes Glieder. Im Vorfeld des Madrider NATO-Gipfels 2022 ist dies der beste Weg, die politische Herausforderung zu beschreiben, vor denen die transatlantische Beziehung steht. Nur der politische Wille der Europäer und ihrer Regierungen kann die Sicherheit unseres Kontinents stärken.
Aus dem Englischen von Jan Doolan